Am 31. Januar 2025 wurde im Deutschen Bundestag über das von der CDU/CSU eingebrachte „Zustrombegrenzungsgesetz“ abgestimmt, das den illegalen Zustrom von Drittstaatsangehörigen nach Deutschland begrenzen und den Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte aussetzen sollte.

Nach hitzigen Debatten wurde der Gesetzentwurf jedoch mit 349 Nein-Stimmen zu 338 Ja-Stimmen bei fünf Enthaltungen abgelehnt. Die FDP enthielt sich größtenteils, während die AfD geschlossen für das Gesetz stimmte. Besonders auffällig war, dass sich innerhalb der CDU/CSU-Fraktion 12 Abgeordnete der Stimme enthielten, was die internen Spannungen innerhalb der Union verdeutlicht.
Mehrheit der Bürger für das Gesetz – aber nicht im Bundestag
Besonders bemerkenswert ist, dass eine Mehrheit der wahlberechtigten Bevölkerung in Deutschland das Gesetz befürwortet. Laut einer INSA-Umfrage vom 30. Januar 2025 sprechen sich 67 Prozent der Deutschen dafür aus, dass die SPD dem Gesetzentwurf hätte zustimmen sollen – darunter sogar 51 Prozent der SPD-Anhänger. Zudem sind 76 Prozent der Bürger mit der aktuellen Migrationspolitik unzufrieden, während 69 Prozent den am 29. Januar verabschiedeten Antrag zum Asyl-Stopp begrüßen. Diese Zahlen zeigen eine wachsende Kluft zwischen der öffentlichen Meinung und den politischen Entscheidungen der Regierungsparteien.
Merz attackiert SPD und Grüne
CDU-Chef Friedrich Merz griff die Regierungsparteien scharf an. An SPD und Grüne gerichtet, sagte er: „Was soll die Bevölkerung davon halten, wenn sie nicht einmal bei so kleinen Schritten zur Entscheidung fähig sind?“ Er warf der Koalition vor, die Sorgen der Menschen vor unkontrollierter Zuwanderung nicht ernst zu nehmen.
Erste Mehrheit mit AfD-Stimmen im Bundestag – und heftige Kritik
Die Abstimmung hatte auch eine historische Dimension, denn es war das erste Mal seit ihrem Einzug in den Bundestag vor acht Jahren, dass ein Gesetz mit den Stimmen der AfD eine Mehrheit hätte erreichen können. Dies löste heftige politische Diskussionen aus. Während SPD, Grüne und Linke Erleichterung über die Ablehnung zeigten, kritisierte CDU-Chef Friedrich Merz insbesondere die FDP für ihre Enthaltung.
Besonders scharf äußerte sich Britta Haßelmann, Fraktionsvorsitzende der Grünen. Sie warf CDU und FDP vor, sich „rechts neben der AfD“ positioniert zu haben, indem sie bereit waren, eine Mehrheit auch mit deren Stimmen zu erreichen.
Scharfe Angriffe aus allen Lagern
Die Debatte um die Abstimmung führte zu gegenseitigen Vorwürfen aus allen politischen Richtungen:
- FDP-Bundestagsvize Wolfgang Kubicki warf den Regierungsparteien ein „Schmierentheater“ in der Asylpolitik vor und kritisierte insbesondere die Grünen für ihre „unmoralische“ Haltung.
- AfD-Fraktionschef Bernd Baumann beschuldigte CDU/CSU, Asyl-Gesetze der AfD „kopiert“ zu haben.
- SPD-Innenministerin Nancy Faeser warnte davor, die Morde von Aschaffenburg und Magdeburg politisch zu instrumentalisieren.
- BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht gab den Regierungsparteien die Schuld am Aufstieg der AfD: „Sie haben die AfD in drei Jahren in den Umfragen verdoppelt.“
Merz unter Druck – zu viele Abweichler in der CDU/CSU
Die Abstimmung offenbarte auch eine interne Schwäche der CDU. Nicht alle Abgeordneten der Union stimmten geschlossen für den Gesetzentwurf, was nicht nur das Wahlergebnis beeinflusste, sondern auch Fragen zur Führungsstärke von Friedrich Merz aufwarf.
Demonstrationen eskalieren – Angriff auf CDU-Zentrale
Nach der Abstimmung kam es in zahlreichen Städten zu Protesten. Tausende Menschen demonstrierten gegen eine mögliche Zusammenarbeit der Union mit der AfD und gegen den Kurs der CDU in der Migrationspolitik.
In Hannover eskalierten die Proteste, als Linksextremisten die Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbands stürmten, Protest-Plakate aufhängten und Bengalos zündeten. Die CDU erstattete daraufhin Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs.
Wenn Parteien gegen politische Gegner demonstrieren, ist die Demokratie in Gefahr
Es ist eine gefährliche Entwicklung, wenn Parteien oder ihre Anhänger zu Demonstrationen gegen politische Gegner aufrufen. Während das Recht auf Versammlungsfreiheit ein Grundpfeiler der Demokratie ist, kann die gezielte Mobilisierung gegen andere Parteien den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden und die politische Kultur vergiften.
Welche Lösungen gibt es?
- Direkte Demokratie stärken
Ein Volksentscheid über zentrale Fragen der Migrationspolitik könnte sicherstellen, dass der Wille der Mehrheit umgesetzt wird. - Politische Kurskorrektur der Regierung
Die Regierungsparteien müssen erkennen, dass eine große Mehrheit der Bevölkerung eine strengere Migrationspolitik fordert. Sie sollten sich an sachlichen Debatten orientieren und nicht nur aus ideologischen Gründen blockieren. - Demokratische Diskussionskultur bewahren
Parteien müssen den gegenseitigen Austausch suchen, anstatt sich in ideologischen Kämpfen zu verhärten. - Konsequenzen aus der Wahlurne
Wenn die Kartellparteien nicht auf die Sorgen der Bürger eingehen, bleibt als letzte Konsequenz der Wahlzettel. Die Bevölkerung kann durch ihre Stimme entscheiden, ob sie weiterhin von diesen Parteien regiert werden will oder ob sie eine echte Veränderung herbeiführt.
Quellen:
- Deutscher Bundestag – Abstimmungsergebnisse
- Bild.de – Umfrage: Mehrheit für CDU-Gesetz
- Tagesschau.de – Merz kritisiert Ampel-Blockade
- Grüne Bundestagsfraktion – Pressemitteilung
- Bild.de – Linksextreme greifen CDU-Gebäude an
- Yahoo News Deutschland – AfD über CDU-Strategie
- Spiegel.de – Faeser zu den Anschlägen
- Focus.de – Wagenknechts Kritik an der Regierung
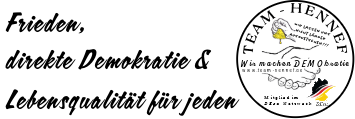
Eine Regierung die gegen ihre eigene Bevölkerung handelt muss weg meine Angst ist das ein Bundespräsident sich dahin geäußert hat wenn ihm unsere Wahl nicht gefällt könnte er diese annullieren Gott sei mit uns